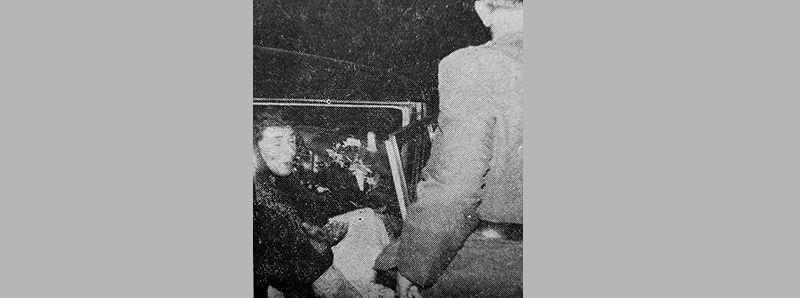Katharina Franz, Generalanzeiger, 16.9.1966. Mit frdl. Genehmigung der WZ / Westdeutschen Zeitung.
Katharina Franz
Katharina Franz wurde als Zugehörige der Sinti*zze und Rom*nja mit ihrer Familie von den Nationalsozialisten verfolgt und hat mehrere Konzentrationslager überlebt.
Ihr Schicksal wird unter den wenigen vorhandenen Biographien1 nur kurz aufgegriffen und soll deshalb hier beispielhaft Erwähnung finden.
Geboren wurde Katharina Franz am 20.3.1914 in Saarlouis als Katharina Winter, später korrigiert auf Katharina Lind, da ihre Mutter ledig und nicht standesamtlich verheiratet gewesen war. Am 27.11.1933 heiratete Katharina den Musiker Oskar Franz, geboren am 29.9.1911 in Worms. Mit ihm bekam sie acht Kinder.
Siedlung Klingholzberg 1963. Mit freundlicher Genehmigung von www.manfred-voss.de
„Die städtische Notsiedlung Klingholzberg in Barmen diente wohl als eine Art inoffizielles kommunales Zigeunerlager.“2 „Der Klingholzberg mit Hildburgstraße wurde ab 1987 Heinrich-Böll-Straße genannt.“3
Dort lebte auch die Familie Franz vor ihrer Deportation nach Auschwitz. Wo die Familie vorher gelebt hatte, war nicht eruierbar, ebenso wenig das Schicksal zwei ihrer Kinder, die nicht nach Auschwitz deportiert wurden.
Vermutlich waren ein Säugling und Kind Nora, geboren 1941 in Barmen, bereits vorher verstorben, laut Aussage einer Haushaltshilfe von Familie Franz. Die Familie hätte mit ihren sechs Kindern in einer „gut eingerichteten Zweizimmerwohnung gelebt und keine Not gehabt“4.
Vom Klingholzberg wurde Katharina Franz, 29 J., am 3.3.1943 mit ihrem Mann und sechs Kindern, von dort zusammen mit acht weiteren Familien nach Auschwitz-Birkenau deportiert. Am 9.3.1943 ist die Ankunft dort dokumentiert. Ihre Häftlingsnummer war Z-1912.5
Über Oskar Franz ist dokumentiert, dass er am 23.6.1944 aus der Strafkolonie ins Lager zurückverlegt wurde. Seine Häftlingsnummer war Z-1717. Sein Todesort und –zeitpunkt ist unklar. Es wird der 18.9.1944 im KZ Sachsenhausen oder am 13.9.1945 in Breslau genannt.6
Katharina Franz wurde noch in mehrere KZs verschleppt. Im April und Mai 1944 sind Transporte von Auschwitz nach Ravensbrück dokumentiert. Im KZ Ravensbrück wurde sie zwangssterilisiert.7
Nach welcher Methode die Zwangssterilisation durchgeführt wurde, ist der Wiedergutmachungsakte von Katharina Franz nicht zu entnehmen. Sie findet in ihrer Akte auch keine Erwähnung als besonders unmenschliche und verächtliche Behandlung. „Bei Frauen versuchte man in den meisten Fällen, die Eileiter unwegsam zu machen…In über 90 Prozent aller Fälle wurde der im Hinblick auf Infektionen gefährlichere Leibschnitt dem für die Patientin schonenderen Leistenschnitt vorgezogen. Der operative Eingriff war daher besonders für Frauen nicht ungefährlich.“8
Im August 1944 wurde das Familienlager der Sinti*zze und Rom*nja in Auschwitz aufgelöst. Am 7.3.1945 ist die Ankunft von Katharina Franz im KZ Mauthausen und am 17.3.1945 der Weitertransport nach Bergen-Belsen dokumentiert. Am 15.4.1945 wurde sie in Bergen-Belsen zusammen mit den Kindern Harry, Z-1079 (6 J.) und Luise, Z-1916 (11 J.) von den britischen Truppen befreit.9 Auch Willi, Z-1716 (13 J.) wurde befreit10, allerdings nicht zusammen mit Mutter und Geschwistern. Sie hatten über zwei Jahre ihrer Kindheit in KZs verbracht.
Danach war Katharina Franz wieder am Klingholzberg in Wuppertal gemeldet. Die Töchter Maria, Z- 2998 (8 J.), Lydia, Z-1915 (3 J.) und Anna, Z-1913 (3 Monate) waren in Auschwitz ermordet worden.11
„Das Lager bedeutete für die Häftlinge eine weitgehende Zerstörung der Persönlichkeit, das Ausgeliefertsein an die SS und für Juden, Roma und Sinti zudem die permanente Furcht, zur Erstickung im Gas selektiert zu werden… Das Handeln der Häftlinge wurde fast ganz von den elementarsten Bedürfnissen diktiert…Die erlernten Normen des gesellschaftlichen Zusammenlebens konnten um den Preis des Überlebens nicht gewahrt werden.“12
Ihr Wiedergutmachungsantrag wurde am 25.3.1950 abgelehnt, mit der Begründung, dass sie nach 1945 straffällig geworden sei. Im April 1949 wurde sie wegen Hehlerei verurteilt, nachdem sie das aus einem Raubmord erbeutete Geld, begangen durch Sohn Willi, aufbewahrt hatte.13
„Generell wurden Entschädigungsansprüche für Internierung in Zigeunerlagern, Verschleppungen in Konzentrationslager sowie Zwangssterilisierungen oftmals verweigert.“14
Zudem hatten die Betroffenen „weder eine eigene Anlaufstelle für Fragen der Wiedergutmachung gebildet, noch wurden sie von den Vertretern anderer Verfolgter in die Ansprüche kollektiver Wiedergutmachung miteinbezogen. Letztlich muss auch aus moralischer Sicht die Frage gestellt werden, ob es den Betroffenen gegenüber korrekt war, von ihnen Antragstellung und Beweislast zu erwarten, wenn ihnen die Verfolgung, wie z.B. Schulausschluß, Wegnahme von Papieren, die entstandene Angst vor Behörden u.a. hierzu die notwendigen Voraussetzungen genommen hatten.“15
Auch nach der Entlassung aus dem Gefängnis wohnte sie 1949 wieder am Klingholzberg, zusammen mit den Kindern Luise (15 J.) und Harry (9 J.). Zeitweise wohnte auch Renaldo, Sohn von Sohn Willi16, also ihr Enkel, bei ihr.
Die Bearbeitung des Entschädigungsantrags von Katharina Franz zog sich über elf Jahre hin. Sie erhielt eine Witwenrente von Oskar Franz und eine Waisenrente für Harry und Luise.
Es folgen zahlreiche Unterkünfte, zehn verschiedene in 20 Jahren, Wohnwagen, Bunker Varresbeck, Gartenlaube, Gartensiedlung und Notsiedlung.
In einer Beschreibung aus ihrer AfW-Akte heisst es z.B. zu einer Gartenlaube: „Diese Laube befindet sich in einem so schlechten Zustande, dass die Familie den Winter darin nicht verbringen kann.“
„Der Bunker Varresbeck ist ein Dach über dem Kopf, aber nicht mehr.“17 Grundsätzlich ist festzustellen, dass die Behausungen, soweit dokumentiert, überwiegend sehr ärmlich waren.18
Bunker Varresbeck, Friedrich-Ebert-Str. 304, Foto: Dr. Eva Waldschütz
Zu ihrer Person sind nur wenige Angaben zu finden. Im Urteil vom 13.4.1949 ist eine abwertende Beschreibung festgehalten: „Sie ist völlige Analphabetin, hat die Volksschule nicht besucht, stammt aus einer Zigeunerfamilie. ..steht an der Grenze des Schwachsinns.“19
In einer ärztlichen Untersuchung vom 27.9.1956 wird sie als 42-jährig, 162 cm groß, 53 kg leicht und abgemagert beschrieben. Früher hätte sie 89 kg gewogen. Seit ihrer Zwangssterilisation träten prämenstruell Anfälle mit Zungenbiss und Ohnmachten auf. Auch Adnexitiden (Eierstockentzündungen) werden angegeben.
Laut Sohn Harry20 war sie bereits 1945 eine „Zigeunerheirat“ mit Eichwald Ernst Ernsten, Z-3338, eingegangen, den sie dann am 15.9.1966 standesamtlich in Elberfeld heiratete. Er war wie sie auch nach Auschwitz verschleppt worden.
Bei der Hochzeitsfeier in einer Notunterkunft „Am Giebel“ kam es zu einer Schießerei. Sohn Harry hatte den Bräutigam durch einen Bauchschuss verletzt. Die Scheidung wurde kurz darauf eingeleitet. Am 11.12.1968 wurde sie rechtskräftig. Über die nächsten 10 Jahre gibt es keine Dokumente.
Am 20.6.1979 verstarb Katharina Franz in Wuppertal.21
Text: Dr. Eva Waldschütz
Verortung:
Klingholzberg, Wuppertal (Nähe der heutigen Heinrich-Böll-Straße)
Quellen:
1 Lieselotte Bhatia, Stephan Stracke: Vergessene Opfer, Die NS-Vergangenheit der Wuppertaler Kriminalpolizei, Verlag de Noatri, Bremen, Wuppertal, 2018, Stephan Stracke: Die Verfolgung der Sinti und Roma in Wuppertal, S. 294
2 Michael Okroy: „..acht Zigeunerfamilien aus Siedlung abgeholt“, Bruchstücke einer Verfolgungsgeschichte der Sinti und Roma aus Wuppertal, aus „Zigeunerverfolgung im Rheinland und in Westfalen 1933 – 1945“, Hrsg. Karola Fings und Ulrich F. Opfermann, Verlag Ferdinand Schöningh, Paderborn, 2012, S. 287
3 Geschichten vom Klingholzberg, Leben im Brennpunkt, Hrsg. Sozialdienst Katholischer Frauen e.V. Wuppertal, Oktober 2015
4 Wiedergutmachungsakte Katharina Franz, AfW-Nr. 77618, Stadtarchiv Wuppertal
5 Gedenkbuch, Die Sinti und Roma im Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau, Hrsg. Staatliches Museum Auschwitz-Birkenau in Zusammenarbeit mit dem Dokumentations- und Kulturzentrum Deutscher Sinti und Roma, Heidelberg, K.G.Saur, 1993, Bd.1, S. 123/124
6 Wiedergutmachungsakte Oskar Franz, AfW-Nr. 246212, Stadtarchiv Wuppertal
7 S. Wiedergutmachungsakte Katharina Franz, Fußnote 4.
8 Sonja Endres: Zwangssterilisationen in Köln 1934 – 1945, Schriften des NS-Dokumentationszentrums der Stadt Köln, Bd. 16, Emons Verlg. Köln, 2010, S. 205
9 S. Wiedergutmachungsakte Katharina Franz, Fußnote 4.
10 Wiedergutmachungsakte Willi Franz, AfW-Nr. 246354, Stadtarchiv Wuppertal
11 Wiedergutmachungsakte Lydia, Anna und Maria Franz, AfW 246717, 246718, 276719, Stadtarchiv Wuppertal
12 Michael Zimmermann: Rassenutopie und Genozid, Die nationalsozialistische „Lösung der Zigeunerfrage“, Hamburger Beiträge zur Sozial- und Zeitgeschichte, Bd. 33, Hans Christans Verlag, Hamburg, 1996, S. 330/331
13 S. Wiedergutmachungsakte Katharina Franz, Fußnote 4.
14 Zigeunerverfolgung im Rheinland und in Westfalen 1933 – 1945, Hrsg. Karola Fings und Ulrich Friedrich Opfermann, Verlag Ferdinand Schöningh, Paderborn, 2012, Chronologie, S. 335
15 Michael Schenk: Rassismus gegen Sinti und Roma, Zur Kontinuität der Zigeunerverfolgung innerhalb der deutschen Gesellschaft von der Weimarer Republik bis in die Gegenwart, Studien zur Tsiganologie und Folkloristik, Wuppertal, Univ. Diss. 1994, Hrsg. Joachim S. Hohmann, Band 11, Peter Lang Verlg., Frankfurt a. M., S. 315
16 S. Wiedergutmachungsakte Willi Franz, Fußnote 10.
17 S. Wiedergutmachungsakte Katharina Franz, Fußnote 4.
18 Eindruck vom „Klingholzberg“ und „Am Giebel“ unter Manni (http://manfred-voss.de/) (Stand 13. 11 .2023)
19 S. Wiedergutmachungsakte Katharina Franz, Fußnote 4.
20 Wiedergutmachungsakte Harry Franz, AfW-Nr. 11288, Stadtarchiv Wuppertal
21 S. Wiedergutmachungsakte Katharina Franz, Fußnote 4.
22 Karola Fings: Sinti und Roma, Geschichte einer Minderheit, Verlag C.H. Beck, München, 2016, S. 11
23 https://migrations-geschichten.de/porajmos-anfaenge-und-anerkennung-eines-genozids/ (Stand 13. 11. 2023)
24 Gedenkbuch, Die Sinti und Roma im Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau, Hrsg. Staatliches Museum Auschwitz-Birkenau in Zusammenarbeit mit dem Dokumentations- und Kulturzentrum Deutscher Sinti und Roma, K. G. Saur, Heidelberg, 1993, Bd. 2, S. 1553
25 Karola Fings: Sinti und Roma, Geschichte einer Minderheit, Verlag C.H. Beck, München, 2016, Kap. 3. Völkermord, Vernichtung, S. 76/77